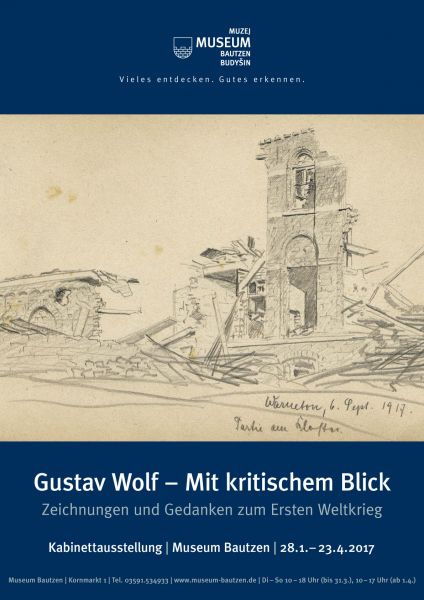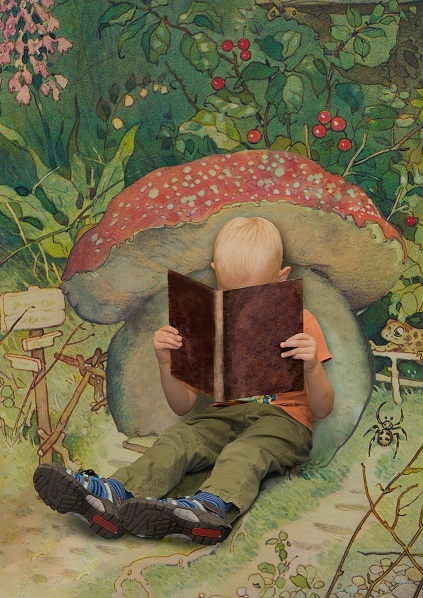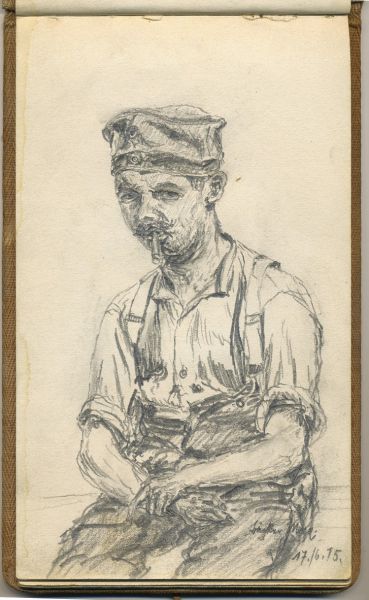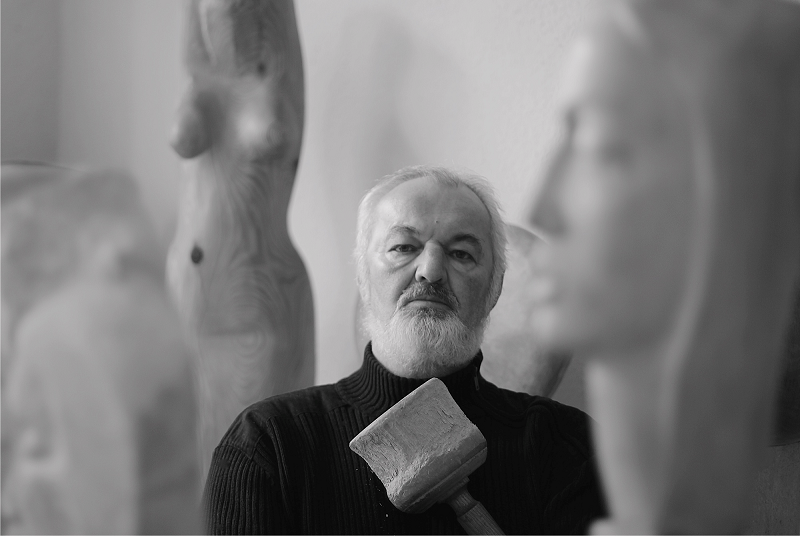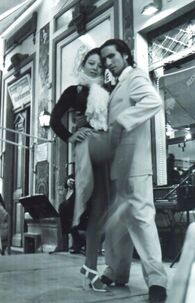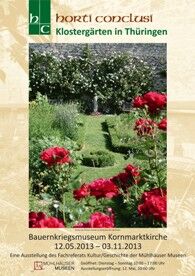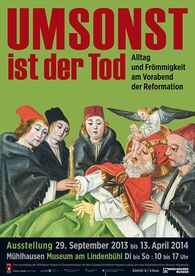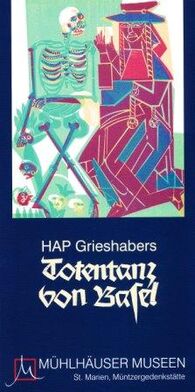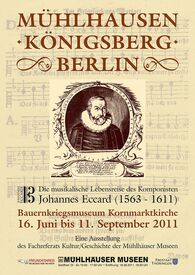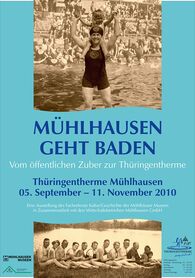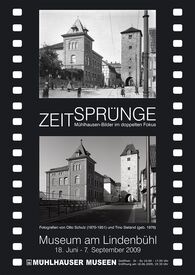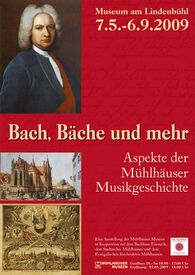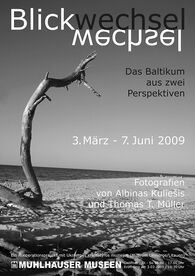„Bach, Bäche und mehr“ – Aspekte der Mühlhäuser Musikgeschichte

Museum am Lindenbühl
07.05.2009 - 06.09.2009
Der Titel der Ausstellung im Museum am Lindenbühl ist eine Reminiszenz an Beethovens Ausruf: „Nicht Bach – Meer sollte er heißen“ – ein treffendes Bild für die Fülle von Werken aus Bachs Feder und seiner musikalischen Ideen.
Dabei waren die Lebensbedingungen in jenem Jahr, als Bach nach Mühlhausen kam, nicht vielversprechend. Nur zwei Wochen bevor Bach seinen Vertrag als Organist am 14./15. Juni 1707 unterzeichnete, brannten große Teile der Stadt ab. Die Not war existentiell und so konnten drei Ratsherren den Umlauf zu Bachs Wahl nicht unterschreiben, weil sie weder Tinte noch Feder besaßen. Dennoch gelang es Bach, ein jährliches Gehalt von 85 Gulden auszuhandeln, etwa 5400 €, womit seine Einkünfte über denen seiner Vorgänger lagen – Zahlungen in Form von Naturalien, wie Holz und Getreide werden noch hinzugerechnet, wie in der Bestallungsurkunde extra vermerkt. Überzeugt hatte Johann Sebastian Bach die Mühlhäuser Arbeitgeber mit der Aufführung der Oster-Kantate „Christ lag in Todes Banden“.
In der freien Reichsstadt war Bach musikalisch in guter Gesellschaft, konnte Mühlhausen doch auf eine lange Tradition mit Namen wie Joachim von Burck, Johannes Eccard, Michael Praetorius, Heinrich Schütz oder die der beiden Ahles zurückblicken. Zu seiner Tätigkeit als Organist der Blasiuskirche kamen andere Aufgaben hinzu – Orgelspiel in „St. Marien“ und der Magdalenenkirche, wahrscheinlich auch in „Allerheiligen“ und „St. Crucis“, Arbeit mit dem Chor und den Stadtpfeifern, Begleitung von Hochzeiten und Beerdigungen. Geschätzt war Bach auch als Orgelfachmann. Sein Vorschlag zum Umbau der Orgel in Divi Blasii wurde zwar erst nach seinem Weggang realisiert, aber er reiste zur Begutachtung derselben an. Es war auch niemand anderes als Albert Schweitzer, der in den 50ern des 20. Jahrhunderts empfahl, die Bachsche Disposition wiederherzustellen.
Die berühmteste Komposition Bachs aus Mühlhäuser Zeit ist ohne Zweifel die Ratswechselkantate von 1708, die mit den optimistischen Worten „Gott ist mein König von altersher, der alle Hilfe tut…“ beginnt. Bach unterschrieb sie damals nach italienischer Manier mit Gio. Bast. Bach (Giovanni Bastiano Bach). Sie blieb die einzige zu seinen Lebzeiten gedruckte Kantate, wodurch sich der Mühlhäuser Rat einen historischen Verdienst erwarb. Diese Kantate kann der Besucher in der Ausstellung hören. Das Gesellenstück eines Diedorfer Orgelbauers veranschaulicht die Funktionsweise einer Orgel; außerdem können Orgelpfeifen aus nächster Nähe betrachtet werden. Anhand von Tafeln mit vielen Abbildungen ist die Mühlhäuser Zeit Bachs wissenschaftlich, aber allgemeinverständlich und umfassend dargestellt. Bis heute daraus erwachsende Traditionen, wie die Arbeit der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ oder des Mühlhäuser Bach-Chores, werden gewürdigt.
Johann Sebastian war übrigens nicht der einzige aus der weitverzweigten Musikerfamilie Bach, der in Mühlhausen tätig war. Ihm folgten Johann Friedrich Bach, ein Vetter, ebenfalls aus Eisenach stammend, als Organist an der Blasius-Kirche und sein dritter Sohn Johann Gottfried Bach, der in der Marienkirche spielte. Die Bedeutung Bachs ist heute unbezweifelt; die Barockmusik wäre ohne ihn nicht denkbar, und es sind die Musikerkollegen, die das zum Ausdruck brachten, z. B. wenn Max Reger sagte, dass Bach „Anfang und Ende aller Musik“ wäre und Robert Schumann gar, dass „wir alle Stümper gegen ihn“ seien.